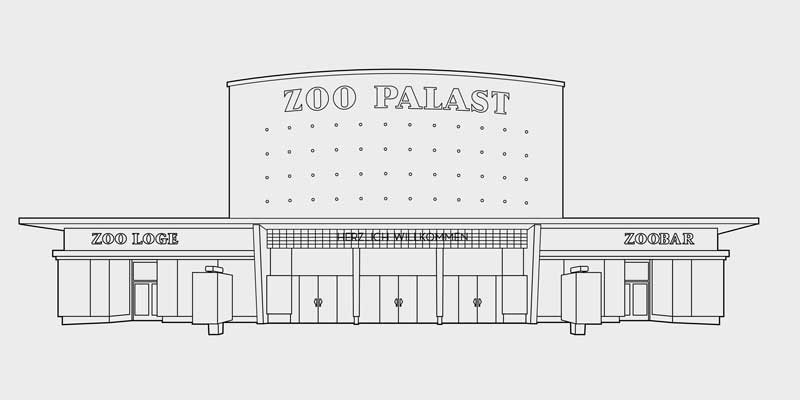Stadtgestaltung und ästhetische Repräsentation
Nach mehrjähriger Bautätigkeit ist der Samariterkiez zur Ruhe gekommen. Von 1993 bis zum Jahre 2008 als Sanierungsgebiet ausgwiesen, stellte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen nach der Aufhebung des Sanierungsstatus fest, dass auf den unbebauten Grundstücken noch 150 Wohnungen gebaut werden könnten. Die freien Flächen sind nun bebaut, die letzten Eigentümer und Mieter beziehen die neu errichteten Eigentumswohnungen.
Doch was ist da eigentlich gebaut worden? Wie verändern die neuen Häuser das Straßenbild? Was ist in die ästhetische Erscheinungsweise ihrer Fassaden eingeschrieben?
Drei Neubauten sollen im Vergleich zur Bestimmung herangezogen werden. Es sind dies das "Bänsch-Quintett", ein Gebäudekomplex zwischen der Bänsch-, der Pettenkofer- und der Dolzigerstraße, dann "AXIS", ein Neubau eine Ecke weiter in der Pettenkoferstraße und schließlich "Polygongarden", ein Neubau der sich zwei Häuser neben "AXIS" befindet, ebenfalls Pettenkoferstraße.
Als Kriterium für eine qualitative Deutung der Häuser beziehe ich mich auf Richard Sennetts Vorschlag einer "kontextbezogenen Gestaltung", die er in seinem Buch "Civitas. Die Großstadt und die Kultur des Unterschieds" vertritt. Eine Gestaltung, die die Kontexte berücksichtigt, basiert auf bescheidenen gestalterischen Akten, die, so Sennett, eine "freundliche Geste" hervorbringen könnten. Das Grundprinzip dieser Gestaltungsauffassung sei "Mutation", bei der es um Aushandeln und Ausgleich gehe.
Als 2012/13 die Bebauung der noch freien Flächen im Samariterviertel anstand, stellte sich ein Teil der Anwohner gegen die geplanten Vorhaben. Sie protestierten für mehr Grünflächen und lehnten die privatwirtschaftliche und marktorientierte Bewirtschaftung ihres Gebietes ab. Mit einer gewinnorientierten Bebauung verband sich die Befürchtung, dass die Mietpreise im Zuge des zunehmenden Anteils an Eigentum ansteigen und so die finanzschwächeren Bevölkerungsteile aus dem Kiez verdrängt werden. Auf dem Spiel stand der Charakter des Kiezes, dessen Stadtgestaltung maßgeblich von seiner Sozialstruktur geprägt wird. Durchgesetzt haben sich die Grundstückseigentümer und Bauträger mit ihren Verwertungsinteressen und Vorstellungen von legitimer Stadtgestaltung.

Der prognostizierte Wandel hat im Samariterviertel stattgefunden, die in den letzten Jahren realisierten Neubauprojekte sind dessen sichtbarer Ausdruck. Nicht ablesbar am Straßenbild hingegen sind die vielen Umwandlungen von Altbauten, die aufgeteilt und in Form von Eigentumswohnungen verkauft wurden und die zum Anstieg der Eigentumsquote beitragen.
Das Haus "AXIS"
Das von Philipp und Hubert Jünnemann entworfene Haus "AXIS" in der Pettenkoferstraße bedient sich einer schlichten Formensprache klarer Linienführungen und Flächenaufteilungen. Die funktionale Raumgliederung des Gebäudes ist an der Fassade ablesbar, man kann erkennen, wo sich die Treppenhäuser, die Wohnungen und die Geschäfte befinden. Die Eingänge zum Gebäude sind ohne Anleihen bürgerlicher Repräsentationsformen gehalten und genügen ihrem funktionalen Zweck eines Zugangs. Die Balkone sitzen vor der Fassade und wirken durch die Einfassung mit Stahlgeländern offen und transparent. Wer auf den Balkon geht, geht aus dem Haus heraus und betritt in gewisser Weise den Straßenraum. Im Verhältnis zu den Häusern des Umfeldes ist "AXIS" unauffällig, da der Grad an ästhetischer Varianz sich innerhalb des allgemeinen Spielraums bewegt, wie er in den historisch älteren Gebäuden zu finden ist.


Das Haus "Polygongarden"
Die ästhetische Erscheinungsweise von "Polygongarden" mit überdimensionierten, spiegelglatten Fensterfronten und einer eigenwilligen Formensprache bildet eine abweisende Grenze zur Straße hin. Aussen- und Innenraum sind in einer betonten Trennung voneinander geschieden. Das Haus fügt sich nicht ein, im Gegenteil, es sticht unter den umstehenden Häusern hervor. Es ist demonstrativ besonders. Die demonstrative Gleichgültigkeit der Ästhetik von "Polygongarden" gegenüber dem Umfeld repräsentiert die Erfüllung der Befürchtungen der Kritiker des Wandels im Samariterkiez auf das Vortrefflichste. In diesem, allen städtebaulichen Kontext ignorierenden, Architektenhaus ist die Macht der privaten Bauwirtschaft Stein geworden.


Von den Eigenschaften des Hauses bleiben die Bewohner nicht unberührt. Sie werden ausgestellt als diejenigen, die sich Eigentum in einem Prestigeobjekt leisten können, die folglich, bezogen auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse, zum oberen Teil in der Sozialhierarchie des Kiezes zu zählen sind.
Es sind Bewohner, die hinter einer Glasfassade als starker, abweisender Mauer ihre Privatheit schützen und zuleich als Zuschauer das Leben der Anderen auf der Straße konsumieren. Und wer auf den Balkon tritt, betritt nicht den Straßenraum wie bei "AXIS", sondern bleibt im Haus.
Die Aggression richtet sich folglich auch gegen "Polygongarden" und nicht gegen "AXIS". Die Fenster von "Polygongarden" werden mit Steinen beworfen, was die Eigentümer zwingt, ihre 20.000 Euro teuren, in die Fassade eingelassenen Glasplatten auszutauschen.
Das Haus "Bänsch-Quintett"
Das von dem Architekten Stephan Höhne entworfene "Bänsch-Quintett" nimmt in seiner Fassade historisierende Bezüge auf. Die Repräsentation sozialen Status und ästhetische Integration in den Altbaubestand scheinen Leitmotive der Gestaltung gewesen zu sein. Die Aufnahme der Ästhetik des Historismus in milder Form in einem Neubau könnte man als eine Kritik an den Möglichkeiten zeitgemäßen Bauens werten, doch darin geht das normative Kalkül der Marktgängikeit des Objektes nicht auf. Wahrscheinlicher ist deshalb, dass hier das Repräsentationsbedürfnis des kleinbürgerlichen Geschmacks bedient wird, der Gefallen findet an den abgelegten Symbolen des sozialen Prestige.


Auch im "Bänsch-Quintett" bleiben die Bewohner nicht unberührt von der Ästhetik des Hauses, die sie ausweist als Angekommene im "Schöner Wohnen". Der Blick zurück in "die Geschichte" amalgiert das Projekt eines Lebens im gemein-gefälligen Ornament mit der konservativen Illusion von Geschmacks- und Stilsicherheit. Die Weichheit der Rundungen täuscht über Unbill und Rauheit des Lebens in der Großstadt hinweg, und deren Zähmung mit den Mitteln der Ästhetik (statt denen der Politik) ist ein altes und gescheitertes Projekt. Wer auf den Balkon tritt, genießt die Aussicht, genießt, angekommen zu sein, im eigenen Heim, im Glück.
In meinen Augen kann man lediglich "AXIS" als eine graduelle Entsprechung der Idee einer kontextbezogenen Gestaltung werten. Dagegen sind das von "Hastrich, Keuthagen Architekten" entworfene "Polygongarden" und das "Bäsch-Quintett" von Stephan Höhne Architektenhäuser in dem Sinne, dass sie Träger einer ästhetischen Formensprache sind, die dem jeweiligen Architekten zueigen ist, sozusagen als Markenzeichen. Wo immer Stephan Höhne oder Hastrich, Keuthagen ein Gebäude realisieren, zeigt sich ein hoher Grad an Invarianz in der Gestaltung, anders gesagt, ein "künstlerischer Stil" oder in einer mehr werblichen Semantik, eine "individuelle Handschrift". Hierin tut sich das Autonomiestreben des Künstlers kund, der sich seinem Werk verpflichtet fühlt, damit aus diesem lediglich variierende Ich-Bekundungen herstellt, die er als "kreative Individualität" in seinen Marktwert einzahlt. Kontextuelle Gestaltung schließt aber die Einschreibung des Gestalterindividuums in den Entwurf als Geste künstlerischer Autonomie aus. Sie ist, um Sennett aufzugreifen, für die Gestaltung der Stadt eine "unfreundliche Geste".